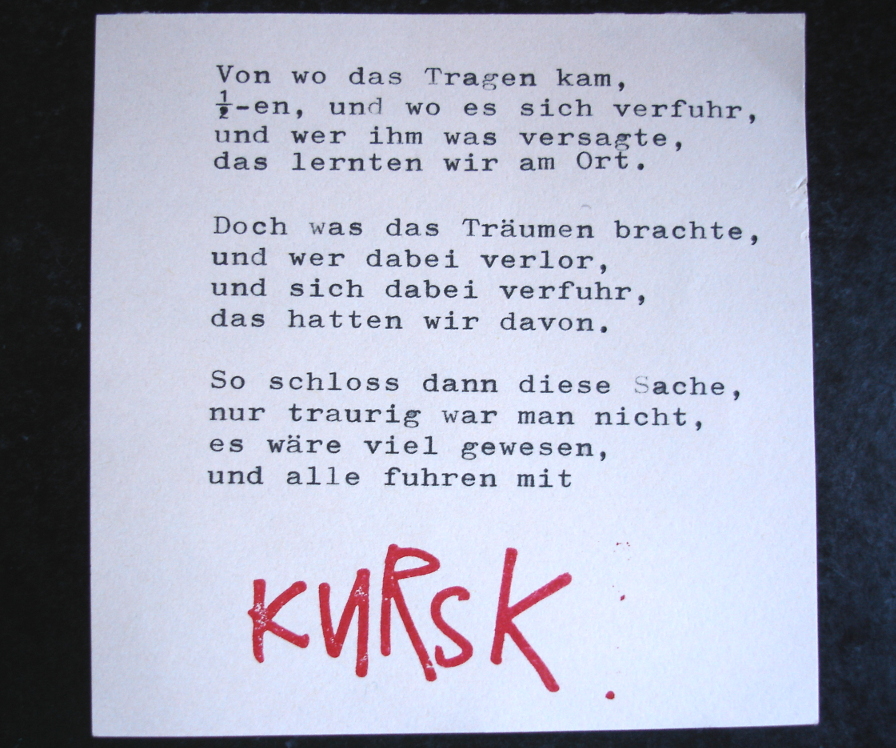Zombies, Vampire. Fleisch und Blut: Die Verdauung der Menschheit.
„When there’s no more room in hell
the dead will walk the earth.“
Dawn of the dead – George A. Romero
Vor einigen Jahren traf ich mich mit Freunden, um den Zombie-Parodien Klassiker Braindead von Peter Jackson anzuschauen. Vorab musste der Film, da damals noch indiziert, illegal heruntergeladen werden. Nichtsahnend öffneten wir also die Datei des Films, darauf gefasst viel Blut, Gedärm und Hirnmasse zu sehen, und erblickten ein kurzes, vielleicht zehn Sekunden dauerndes Standbild, das vom Herausgeber Sickboy88 vor den eigentlichen Film geschnitten worden war. Das Bild, ein Schwarzweissfoto, zeigt einen Berg von nackten, abgemagerten Leichen, die von einem danebenstehenden Raupenbagger, der immernoch mehr Leichen auf seiner Schaufel hatte, angehäuft worden war. Das Foto zeigte das Grauen eines Konzentrationslager, es zeigte das nichtgeschehendürfende Leid von Millionen von Menschen. Ich fragte mich damals, warum dieses Foto von einem Fascho vor diesen Film gestellt worden war und konnte mir keine Antwort darauf geben. Erst letzte Woche, als ich mit einem anderen Essay beschäftigt war, das auch die Schrecken von Auschwitz zum Thema hatte, tauchte in mir die Spur einer Antwort auf. Ich fragte mich, ob nicht die postmoderne Horrorkunst dargestellt als blutrünstige Menschen fressende Vampire und antropophage, hirntote Zombies als Reaktion auf den Holocaust gelesen werden könnte? Was wäre, wenn das Grauen des Holocaust als das neue, nicht in vorhandene Narrative einzureiende Moment im Horror der Popkultur als solches betrachtet werden würde?
Arendt sagt in ihrem Monumentalwerk Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, dass der Holocaust das Grauen und das Moment des „nicht geschehen dürfen“ dadurch hervorruft, weil es nicht in einen Kontiniuitätszusammenhang menschlicher Erfahrung gesetzt werden kann. Nach Auschwitz kann nicht weiter gemacht werden wie zuvor, weil niemand die Verantwortung dafür übernehmen kann, aufgrund der Unmöglichkeit der Verbindung an andere, frühere Erfahrungen oder Katastrophen. Der Holocaust kann keinen Sinn haben in der Welt. Gerade daraus folgert Adorno, dass Kunst nach Auschwitz darum das Grauen und das Leiden, die sich aus den Erfahrungen der Lager ergibt, nie vergessen lassen darf und daher eigentlich keine Kunst mehr möglich wäre. Denn da wo Kunst ist, wird genossen. Dennoch aber, um dieser Erfahrung eine Stimme geben zu können und auch Trost, diese verhandeln muss, womit ihr aber ein Teil des Grauens abhanden kommt. Sie muss den Rezipienten aufrütteln, ihn schrecken und den Widerspruch spüren lassen: Es muss das Grauen erlebt werden, sich einbrennen und eben nie vergessen werden. Denn sowohl für Adorno als auch Arendt sind die Erfahrungen aus Auschwitz nicht ein singuläres Moment, sondern die äusserste Konsequenz totaler Herrschaft, die sich nicht nur im Nationalsozialismus zeigt, sondern auch, wie Adorno meint, in der westlichen Welt, die in einem beschädigten Leben vor sich hinvegetiert, dominiert durch die sich totalisierende Herrschaft der Produktion, des Kapitalismus. Das Ziel jeglicher totalen Herrschaften ist es ein Telos1 zu erreichen, für das die Menschen zu reinen Mittel gemacht werden. Sie werden zu einem reinen Fleischkörper eisern zusammengebunden und exekutiert, um den Prozess der Erreichung des Telos zu beschleunigen. Im Kapitalismus sind die Menschen Mittel dafür, das möglichst viele Waren produziert werden können, die wiederum die Menschen beherrschen. Die Produktion wird ins unermessliche gesteigert, damit ein endloses Wachstum generiert werden kann. Die Menschen sollen in einer scheinbaren Welt leben, der verdinglichten Welt, die absoluten Sinn ergibt, die den Blick verwehrt auf das „eigentliche“ sinnbefreite Leben, der Umkehrung eines Mittel und Zweck-Verhältnisses: Nicht die Produktion arbeitet für die Bedürfnisse der Menschen, sondern die Menschen für die der Produktion.
In 30 days of night, einem amerikanischen Indie-Comic aus dem Jahr 2008, erscheinen aus dem Nichts zwanzig Vampire in der nördlichsten Siedlung der USA, Barrow, Alaska, die im Winter dreissig Tage ohne Sonnenlicht bleibt. Sie sind gekommen, um die 500 Menschen dieses Dorfes, die abgeschnitten sind von jeglichen anderen Menschen, in einer grauschwarzen Einöde aus Eis, zu fressen.
„And so it began. The invasion. The attack. The massacre. It coudn’t have worked out better. The humans never saw them coming, and didn’t know what to do once they arrived. […] They have feasted on the men, women and children of Barrow without mercy and without pause. This is the world of which they have only dreamed. Endless night, and endless supply of blood and meat. This is how it meant to be: humans, like bottles, waiting for their caps to be popped. Some of the blood-meat try to escape. […] But the undead engulfed them and they fell, bleeding into death at the hands of the swarm.»
Menschen verkommen zu Waren, denen als einzige Möglichkeit des Handelns, die Vorbereitung zu sterben, bleibt. Die Menschen sind Fleisch, Gegenstände, die als Nahrungsmittel zur Lebenserhaltung der konsumgeilen, arroganten und sinnlos vernichtenden Untoten dienen müssen. Sie verstecken sich, versuchen sich von der Tatsache ihres Daseins zu verbergen, nur um in den schwarzfinstern Schlund der Vampire zu blicken, die blutig lachen. Die Körper der Menschen werden aufgerieben, nicht nur leergetrunken, sie sind nur noch Brei, die Siedlung dem Erdboden gleichgemacht. Die Sinnlosigkeit wird dialogisch thematisiert: „Wait! P … please … I … I don’t un… understand! No, why is this happening? Please. I’ll do -“, gefolgt von der Verspeisung und dem Anblick des blutumrankten Schlundes, der bekränzt ist von schartigen Zähnen. Sie wird jedoch noch untermahlt durch die Ambivalenz des Vampires als Tötungsmaschine selbst. Der Untote vernichtet: Der, der weder tot noch lebendig ist, der, der wieder aus den Gräber aufersteht, kommt, die Menschen zu töten. Das Grauen ob des sinnlosen Todes und das Schrecken über die Überflüssigwerdung des Menschens ist hier gepaart in äusserst krassen Art. Dennoch wird das Narrativ des üblichen Rache-Splatters übernommen und dadurch verliert das Werk an Kraft und gewinnt an Sinn: Diese graphic novel ist solange erfüllt vom Grauen, der sich im Holocaust zeigt, der Entmenschlichung des Menschen und dessen Vernichtung, solange das Narrativ des Grauens, der Totilitarismuskritik aufrecht erhalten wird. Sobald eine gewisse Katharsis einsetzt und die Menschen sich retten können, dem Morden, dem Grauen einen Sinn verleihen können, dem Ausgeliefertsein durch ihre menschliche Qualität der Spontaneität entkommen können, verliert das Grauen seine Kraft und der Genuss kann einsetzen.
In dem Mammutwerk the walking dead von Robert Kirkman wird diese Erfahrung erbarmungslos verhandelt. Nach einer unbekannten Katastrophe wandelt eine Gruppe Menschen durch eine postapokalyptische Welt voller klassischer Zombies, die aphatisch, hirntot und verwesend durch die Welt treiben. Die Menschen sind eingesperrte Wesen in einer feindlichen Welt, die sie bedroht zu willenlosen Sklaven zu werden, die ewig vegetieren oder in den Mägen der Toten verdaut werden sollen. Auf dem Umschlag meiner Ausgabe der ersten 48 Heften steht geschrieben:
„The world we knew is gone. The world of commerce and frivolous necessity has been replaced by a world of survival and responsibility. […] In a world ruled by the dead, we are forced to finally start living.“
Wie der Titel des Werkes an sich ist auch bei diesen Textstellen nicht klar, wie diese Informationen zu verstehen sind. Ist es auf die Welt, in denen die Menschen als Subjekte frei handeln und bestimmen konnten, oder auf die scheinbare Welt des Konsums bezogen? Gleich der Titel: sind die walking dead die Zombies, die wandernd die Welt in den Abgrund stürzen, oder die übriggebliebenen Menschen, die durch ihr Verhalten erst die Entscheidung über die Zukunft der Menschheit bestimmen? Im Mittelpunkt der Handlung dieser nichtabgeschlossenen Comicreihe stehen nicht die Zombies, sondern die Menschen und ihre zwischenmenschlichen Beziehungen. Es wird die Frage aufgeworfen, wie in einer Situation der Katastrophe ein neues Leben aufgebaut werden kann. Diese Frage stellt sich als schwieriger als gedacht, gerade dadurch, dass die Menschen in ihren Vorstellungen, gespeist aus Traditionen und zu spielenden Rollen, grausamer erscheinen als die Zombies. Es scheint mir, als wäre die Konzeption Adornos, die eines beschädigten Lebens, hier im Scheinwerferlicht dargestellt: Der Vorhang wird gehoben, damit die Menschen auf die zu Fleischmassen verkommenen und zur totalen Vernichtung bereitseienden blicken können, während sie versuchen sich davon und ihren veralteten Strukturen zu lösen und in eine menschenwürdige Zukunft zu gelangen. Auch in diesen Büchern ist das Grauen über den sinnlosen und sinnlos gewordenen Tod vermittelt, der nicht sterbenwollenden Toten und der Degradierung des menschlichsen Lebens zu reinem Fleisch, was sich in den realistisch gezeichneten Gore-Bilder trefflich zeigt, nicht zuletzt in ihren fetischistischen Qualitäten. Die Reihe pendelt sich in das Narrativ des Grauens ein und lässt den Rezipienten nicht entkommen. Insofern ist the walking dead weniger ein postapokalyptisches als vielmehr präapokalyptisches Werk und verhandelt die Möglichkeit einer Utopie der Menschheit oder ihren Untergang durch ihre eigene, geschaffene Verdauung.
1 Der Begriff Telos wird in der Bedeutungsvielfalt des altgriechischen τέλος, das sowohl Ende, Ziel aber auch Zweck bedeuten kann, verwendet. Dies lässt das Determinierende und Prozessartige in totalitären Weltvorstellungen einerseits miteinbeziehen, als auch die Umkehrung von Ziel und Zweck in der Argumentation Adornos, wobei aber das Zielgerichtete und teilweise auch Endliche nicht verloren geht.